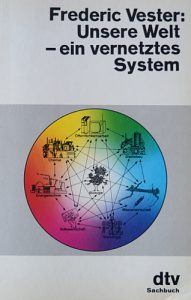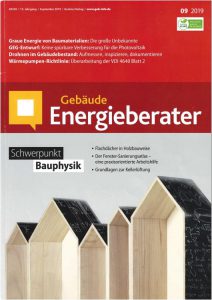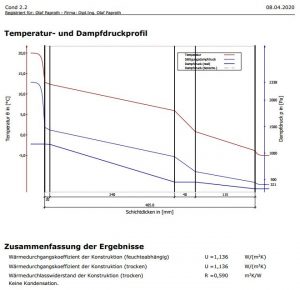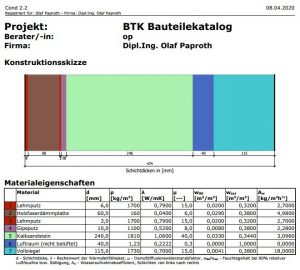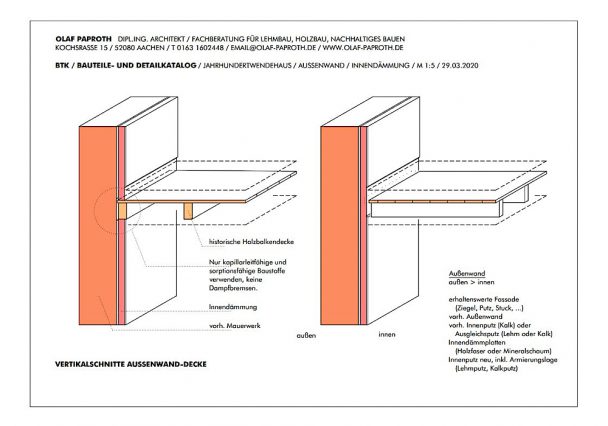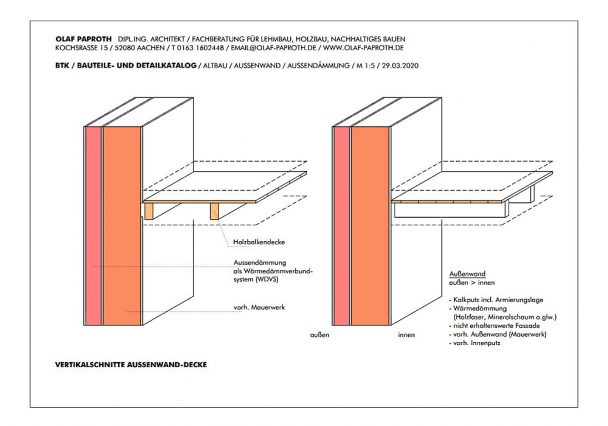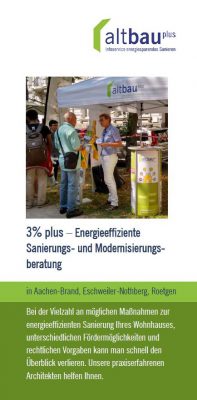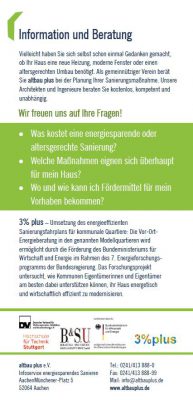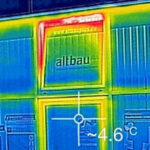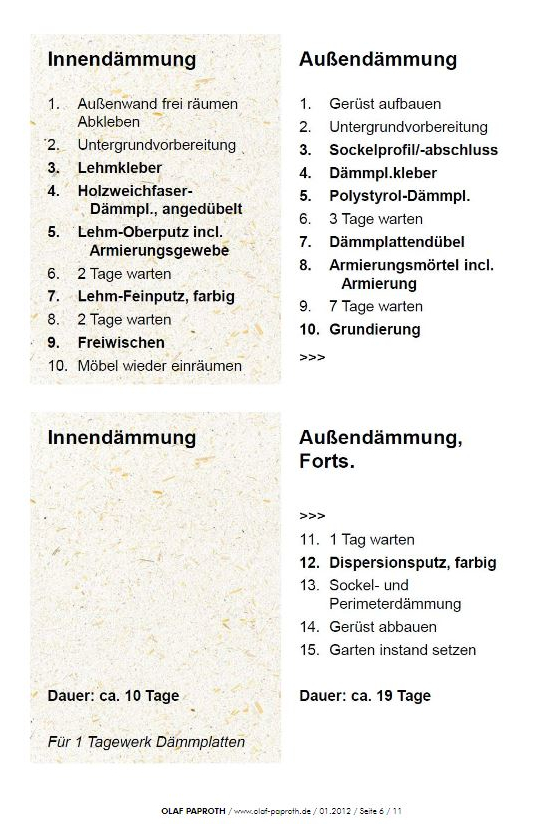„Immer wieder taucht der Wunsch nach Kunststoffenstern auf. Begründet wird dieser meist nur mit der pauschalen Aussage, Kunststoffenster seien besser als Holzfenster. Dabei sind Sie aber schon allein aus haptischen und optischen Gründen eher dritte Wahl. Was tun für eine sachliche Diskussion?“

Holzfenster, historisches Profil, Lasur-Anstrich, EnEV-konform
Warum Kunststoffenster, genauer PVC-Fenster, kritisch zu betrachten sind, wird bei Wikipedia hinreichend beschrieben. Hier sei nur ihre Nachhaltigkeit infrage gestellt – und ihr architektonischer Wert. Holzfenster sind in diesem Zusammenhang kaum zu schlagen.
Ich halte Kunststoffenster im Wohnungsbau grundsätzlich für überflüssig, denn fachgerecht hergestellte und eingebaute Holzfenster stehen guten Kunststoffenstern nicht nur in Nichts nach, meist sind sie insgesamt die Besseren – insgesamt = in der Gesamtbilanz aller Qualitätsmerkmale. Soll der Pflegeaufwand minimiert werden (Das ist der einzige, mir bekannte Grund, für die obige Pauschalaussage), bieten sich Holz-Aluminium-Fenster an. Deren Preis ist heute nur wenig teurer und armortisiert sich in kurzer Zeit.
Wir wollen an dieser Stelle aber keine Abhandlung über PVC, Holz oder Aluminium in Form von Fenstern diskutieren, sondern ein paar einfache, praktische Hinweise geben, wann ein Holzfenster funktioniert und wann nicht. Die Aufzählung ist auch nicht vollständig. Sie ist dafür gedacht, die weit verbreitete Engstirnigkeit im Umgang mit dem Thema zu erweitern und den Fokus auf handwerklich saubere Arbeit zu lenken.

Holzfenster, Südwest-Ausrichtung, 30! Jahre alt (die Schwarz-Weiß-Darstellung zeigt die Fehler besonders gut)
Bei diesem Fenster sind einige grundlegende konstruktive Fehler zu sehen:
Das „Dachschindelprinzip“ wurde nicht eingehalten. Ein Wetterschenkel am Flügelprofil fehlt. Statt dessen wurde das Regenwasser in eine Rinne im Blendrahmen geleitet. Von dort soll das Wasser durch eine einzige Öffnung wieder austreten. Die Rinne im Innern des hölzernen Rahmens weist kein Gefälle zur Entwässerungsöffnung hin auf. Wie soll hier – geplant eindringendes – Wasser vollständig abfließen? So, wie es ist, bleibt immer Wasser/Feuchtigkeit stehen. Was hat Regenwasser überhaupt IN einem Fensterrahmen zu suchen? Richtig, nichts. Der klassische Wetterschenkel unserer Großväter wäre hier richtig gewesen.
Nächster Fehler: Keine Tropfkante zur Fensterbank, sondern bündiges ansetzen. Herunterlaufendes Wasser kriecht hier in die Fuge und hält den Blendrahmen feucht. Der sollte aber möglichst zügig trocken können.
Gleiches gilt analog für die senkrechte Leiste des Blendrahmens links. Sie ist nicht mit dem waagerechten Profil verleimt. Es bildet sich eine Fuge, in die Wasser eindringt. Den Rest zeigt das Bild.
Die mittlere senkrechte Anschlagleiste ist unten waagerecht anstatt schräg abgelängt. Dadurch bleiben immer Wassertropfen hängen. Die Feuchtkeit kann in das Hirnholz eindringen.
Die untere, waagerechte Abschlussleiste wurde nach dem Einbau angesetzt. Der Ansatz an den Blendrahmen wurde mit Acryl abgespritzt, weil der Ansatz nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Es entstand eine Fuge, durch die Wasser hinter die Leiste gerät – durch die Risse im Acryl auch.
Zurück zum Dachschindelprinzip: Hier ist dem entgegengesetzt gearbeitet worden. Das Holzfenster wurde ähnlich wie Kunststoffenster konstruiert. Für die ist es zwar auch nicht intelligent, Wasser durch den Rahmen zu führen, aber möglich. Für dieses Holzfenster muss festgestellt werden, dass sein Fensterbauer keine Ahnung von Holz hatte. Ein einfacher Wetterschenkel, der über die untere Anschlussleiste reicht, hätte das Fenster robuster gemacht. Wetterschenkel können so konstruiert werden, dass sie sich leicht austauschen lassen. Das verlängert die Lebensdauer des Fensters noch einmal.
So ist es fast erstaunlich, dass das Fenster tatsächlich inzwischen 30 Jahre alt ist und ansich bestens funktioniert. Es ist dicht, stabil und sicher. Ermöglicht hat das der richtige Anstrich. Anstatt, wie früher oft üblich, das Fenster mit einem Lack anzustreichen, wurde eine offenporige, pigmentierte, UV-stabile Naturöl-Farbe verwendet, sowohl für den Erstanstrich als auch für die Folgeanstriche. Die Bilder zeigen den Anstrich von vor 8 Jahren. Es ist eine sonnenbeschienene Wetterseite.
Also, wir haben festgestellt, dass der Werkstoff Holz seine Regeln hat. Ein Handwerksmeister kennt seine Materialien und hält sich an die Regeln.