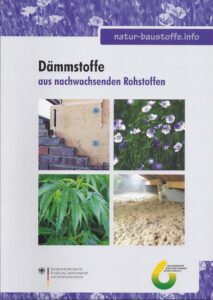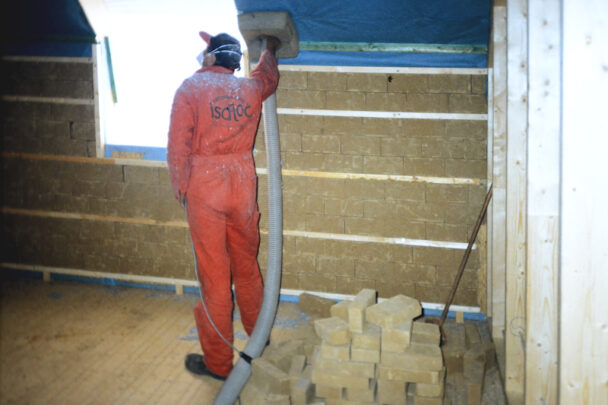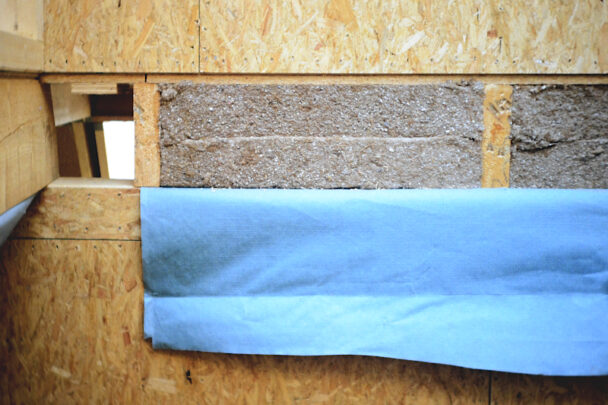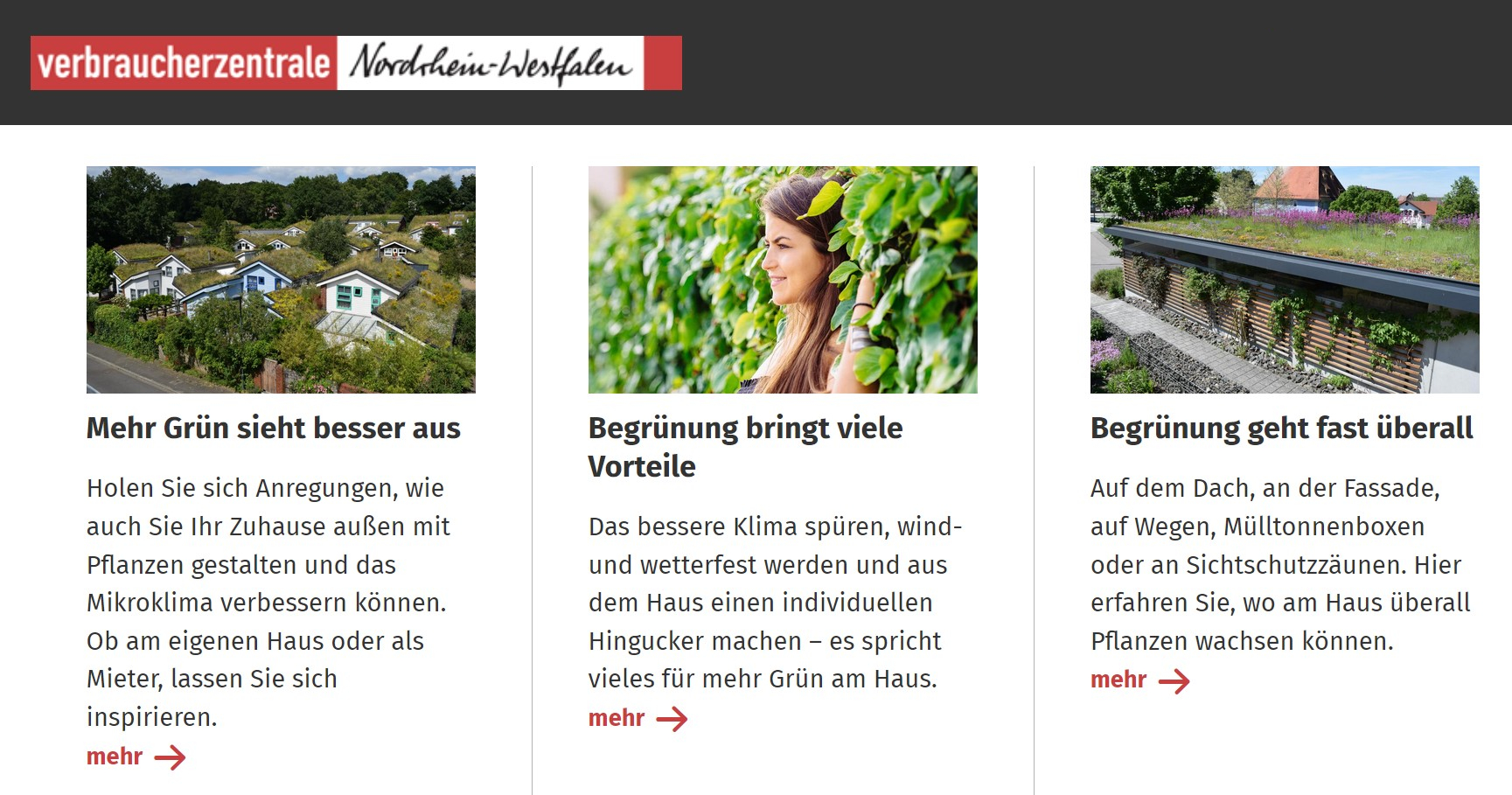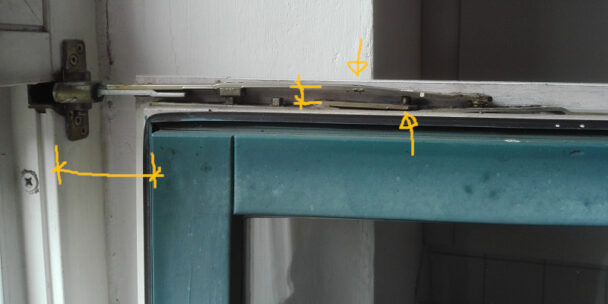In Altbauten, gerne in Jahrhundertwendehäusern, sind die Kanten zwischen Wand und Decke regelmäßig profiliert oder einfacherer als Hohlkehle ausgeführt. Da uns die Decke auf den Kopf gefallen war – im wahrsten Sinnen des Wortes – wollten wir auch diese Rundung wiederherstellen.

Wir wollten es mit unserem Lieblingsbaustoff Lehm ausführen. Mit dem können wir einfach besser umgehen als mit Kalk oder Gips. (Über Gips könnte man in diesem Haus streiten, wollen wir an dieser Stelle aber nicht.) Also Lehmputz sollte es sein. Für die grobe Form haben wir Lehmunterputz mit Stroh verwendet. Der kann recht dick aufgetragen werden und reißt beim Trocknennur wenig. Allerdings kann er nicht fein ausgezogen werden.

Die zweite Schicht ist folglich Lehmfeinputz für die Feinarbeit – der Name sagt´s. Doch auch das reicht nicht, denn auch dieser kann nicht „auf Null“ ausgezogen werden. Geschliffen werden können beide nicht. Das schleifen hilft aber, am Ende eine saubere Rundung auszuformen. Die letzte Schicht war Lehmspachtel, der zwischen 3 und 0 mm Schichtdicke aufgetragen und geschliffen werden kann.


Ein Stukateur, eine Stuckateurin ziehen Profile und Rundungen mit Schablonen. Unsere Rundung war zu groß, um eine Flasche Wein als Ersatz zu benutzen. Champagner gab´s nicht, wir waren ja noch nicht fertig. Stücke aus Abflussrohren passten auch nicht. Also haben wir uns eine simple Schablone für die grobe Form angefertigt aus Resten der OSB-Platten, mit denen wir den Boden abgedeckt hatten. Alles weitere war dann „aus der Hand“. Zum Schleifen haben wir uns Stücke der Wärmedämmung von Warmwasser- bzw. Heizungsrohren aus Schaumkunststoff zurecht geschnitten. Besser wäre es gewesen, einen Schleifblock, der dem gewünschten Radius genauer entsprochen hätte. So ganz einfach ist es nicht wirklich saubere Rundungen aus der Hand herzustellen. Das bedarf tatsächlich einiger Übung.

Die Kelle gehört zu meinem geliebten Japan-Kelle-Satz, klein, elastisch, inzwischen leicht gebogen, sehr hilfreich.
Zum Schluss haben wir mit Silikatfarbe weiß gestrichen. Den im Original nicht ganz so leuchtend roten Lehmfarbputz (roter Lehm, keine Pigmente) des Fotos haben wir erst als letztes aufgebracht. Die gelben Flächen sind feinkörnige Grundierung, die nicht verputzt wurden, sondern mit den Küchenschränken verdeckt wurden.